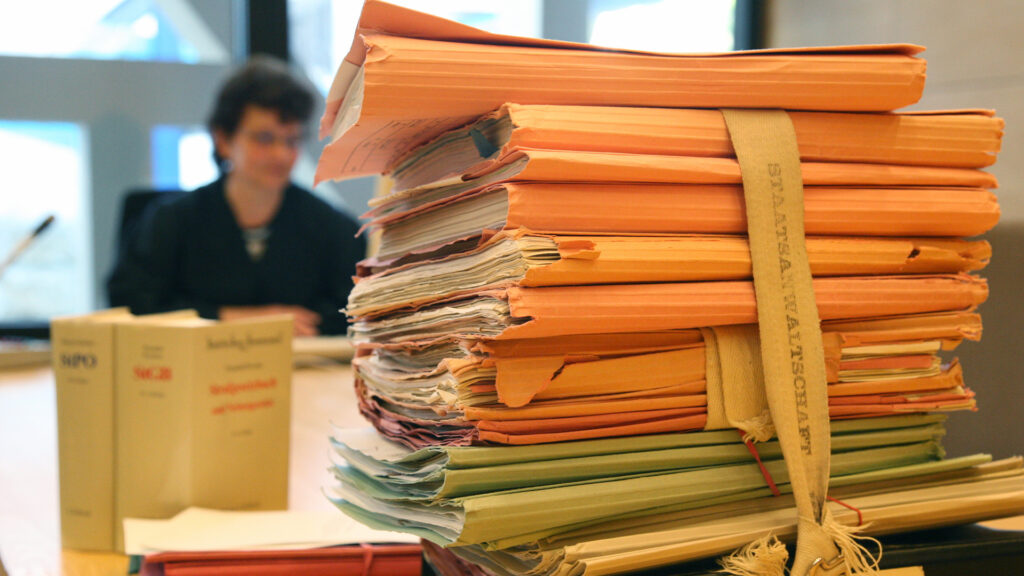„Wir müssen weg von der Dorflinde“ – mit dieser Aufforderung hat Hessen auf den seit Jahren bestehenden Reformstau im Strafverfahrensrecht hingewiesen. Jetzt gilt es für die kommende Reformkommission, in die Breite zu denken und auch mutige Vorschläge zu machen. Hessen drängt auf eine zügige Umsetzung.
Der Druck aus den Ländern zeigt Wirkung: Nun hat die neue Bundesregierung aus Union und SPD den zügigen Abschluss eines weiteren Pakts für den Rechtsstaat angekündigt. Neben die Finanzierungszusage des Bundes in Höhe von 450 Millionen Euro für die Digitalisierung und zusätzliche Stellen wollen Bund und Länder in einer „Zweiten Säule“ umfassende Reformen für eine Effektivierung und Beschleunigung der Prozessordnungen stellen. Reformbedarf besteht vor allem mit Blick auf das Strafverfahren. Die nun angekündigte Reformkommission ist nicht die erste ihrer Art. Viele Reformvorschläge liegen seit Jahren auf dem Tisch. In der Vergangenheit hat es an politischer Durchsetzungskraft gemangelt. Mittlerweile hat die Belastung der Strafjustiz der Länder aber ein Ausmaß erreicht, das dauerhaft nicht durch die Hereingabe von finanziellen und personellen Mitteln zu lösen sein wird, sondern dringendes gesetzgeberisches Handeln erfordert. Der Bund muss daher den Forderungen der Justizministerkonferenz nachkommen und den seit Jahren bestehenden Reformstau auflösen und damit zu einer strukturellen Entlastung der Strafjustiz beitragen. Dabei muss in die Breite gedacht werden. Neben der strafgerichtlichen Hauptverhandlung müssen auch die besonderen Arten des Verfahrens und das Rechtsmittelrecht mitgedacht werden. Im Vordergrund muss die Frage nach der Funktionalität der geltenden Regelungen stehen und ob der gesetzliche Zweck, der womöglich nach wie vor aktuell und legitim ist, nicht zeitgemäßer umgesetzt werden kann. Viel zu oft scheitern Reformbemühungen an reflexartigen Abwehrbewegungen, die eine geltende Regelung für zwingend notwendig erklären, ohne ernsthaft geprüft zu haben, ob diese nach wie vor notwendig ist.
Hierzu gehört eine Ausweitung des Strafbefehlsverfahrens. Dieses Verfahren hat sich seit Jahrzehnten bei der Ahndung einfacher Delikte bewährt. Wenn im Hintergrund die Überschaubarkeit des Sachverhaltes und die Einfachheit der Rechtslage entscheidende Kriterien für seine Durchführung sind, spricht wenig dagegen, es auch auf entsprechende Fälle anzuwenden, die eine einjährige Freiheitsstrafe übersteigen. Dies sollte jedenfalls für Verfahren bis maximal zwei Jahre Freiheitsstrafe gelten, bei denen regelmäßig eine Bewährungsstrafe in Betracht kommt. Unter denselben Voraussetzungen sollten Strafbefehle darüber hinaus nicht nur von den Amtsgerichten, sondern auch von Land- und Oberlandesgerichten erlassen werden können.
Italien als Vorbild – Verkürztes Verfahren
Im Übergang zur Hauptverhandlung könnte ein interessanter Diskussionspunkt die Einführung eines abgekürzten Verfahrens nach italienischem Vorbild sein, bei dem mit Zustimmung des Angeklagten und der Staatsanwaltschaft eine Verurteilung allein auf der Grundlage des Ergebnisses der Ermittlungen nach Aktenlage gegen Gewährung eines Strafrabattes erfolgt. Auch das schweizerische Strafprozessrecht kennt ein vergleichbares abgekürztes Verfahren. Die Überlegungen zur Reform der Hauptverhandlung müssen vorrangig umfangreiche und komplexe Verfahren in den Fokus nehmen. Hier verhindert vor allem der dem deutschen Strafverfahrensrecht traditionell zugrunde liegende Unmittelbarkeitsgrundsatz die erforderliche Effektivierung. Das Ziel muss daher darin bestehen, dass nicht mehr alle Aktenbestandteile, auf die das Gericht sein Urteil stützen will und die den Beteiligten bekannt sind beziehungsweise durch hinreichendes Aktenstudium bekannt sein könnten, in der Hauptverhandlung ausdrücklich und einzeln eingeführt werden müssen. Dabei ist eine Umgestaltung des Unmittelbarkeitsgrundsatzes in unterschiedlichen graduellen Abstufungen denkbar. Fachlich komplexer und politisch ungleich schwieriger durchzusetzen dürfte eine weitgehende Abkehr vom Prinzip der Unmittelbarkeit sein. Dennoch sollte hierüber ernsthaft nachgedacht und Vorschläge erarbeitet werden. Der Akteninhalt könnte demnach schon mit der Eröffnung des Hauptverfahrens durch das Gericht als eingeführt betrachtet werden. Es käme danach in erster Linie dem Gericht zu, nach pflichtgemäßem Ermessen darüber zu entscheiden, welche Beweismittel Gegenstand einer persönlichen Einvernahme in der Hauptverhandlung sein müssen. Die Rechte des Angeklagten könnten wiederum durch ein umfassendes Beweisantragsrecht abgesichert werden.
Jenseits einer völligen Neugestaltung können sich Reformüberlegungen auch innerhalb des bestehenden Systems bewegen und die schon jetzt vorhandenen und zur Effektivierung eingeführten Durchbrechungen des Unmittelbarkeitsgrundsatzes ausbauen. So könnten die Prozessbeteiligten sämtliche Augenscheinobjekte durch Ausweitung des zustimmungsfreien Selbstleseverfahrens selbst in Augenschein nehmen, ohne dass dies in der Hauptverhandlung geschehen muss. Darüber hinaus müssen bestehende Regelungen der Strafprozessordnung zur Bewältigung von massenhaften und vergleichbaren Beweiserhebungen ertüchtigt werden. So sollten zukünftig beispielsweise in Betrugsverfahren mit einer Vielzahl von Geschädigten gleichförmig ausgestaltete Zeugenfragebögen regelmäßig – entgegen der gegenwärtigen Rechtslage – auch ohne die Zustimmung der Beteiligten und über die schon in § 251 StPO normierten Fälle hinaus verlesen werden können. Dies würde umfangreiche Beweisaufnahmen entschlacken und die Verhandlungsdauer minimieren. Um den Rechten des Angeklagten Rechnung zu tragen, könnte für die Verfahrensbeteiligten eine Widerspruchsmöglichkeit, wie derzeit bereits im Rahmen des Selbstleseverfahrens nach § 249 Abs. 2 Satz 2 StPO vorhanden, geschaffen werden.
Schließlich muss auch das im Rechtsmittelrecht liegende Beschleunigungspotenzial geborgen werden. Dies betrifft vor allem den Instanzenzug. Wir sollten generell dazu kommen, dass Strafverfahren in nur zwei Instanzen, das heißt in einer Tatsachen- und einer Rechtsmittelinstanz, abgeschlossen werden. Auch jetzt gilt dies schon für Verfahren vor den Strafkammern der Landgerichte und Jugendstrafverfahren. Warum dies beim amtsgerichtlich verhandelten Ladendiebstahl anders sein soll, erschließt sich nicht. Ob darüber hinaus Berufungen gegen amtsgerichtliche Urteile überhaupt angenommen werden, sollte das Berufungsgericht in Fällen einer Verurteilung bis zu 60 Tagessätzen und nicht bloß bis 15 Tagessätzen Geldstrafe entscheiden können.
Mit dem Abschluss eines neuen Pakts für den Rechtsstaat leiten Bund und Länder eine anspruchsvolle, aber auch notwendige Reformagenda für die Justiz in Deutschland ein. Es wird insbesondere die Umsetzung der „Zweiten Säule“ sein, die über seinen langfristigen Erfolg entscheiden wird.